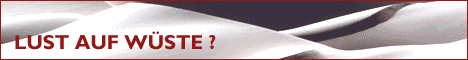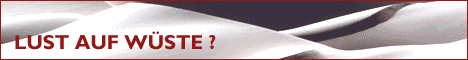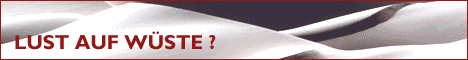
Teil 4: Libyen
Die Strecke der toten Kamele - Libyen
Wir machen uns auf die Suche nach der libyschen Grenzkontrolle. Doch selbst nach 20 Kilometern gibt es nicht den geringsten Hinweis auf eine Zollstation. Dann steht plötzlich ein Schreibtisch mitten auf der Straße. Allgemeines Chaos, Libyer und Tunesier rennen durcheinander und sind fleißig damit beschäftigt, Kofferräume ein- und auszuladen. Wir halten an und werden zu einem Container geschickt, in dem die Pässe kontrolliert werden. Man reicht uns eine grüne Einreisekarte, die wir ausfüllen sollen. Doch leider ist der gesamte Text nur in Arabisch. Zunächst Ratlosigkeit, da keiner der anwesenden Zöllner Englisch oder Französisch spricht. Wir beginnen, die arabischen Worte auf der Einreisekarte mit unserer Paßübersetzung zu vergleichen. Diese Übersetzung haben wir zu Hause machen lassen, da sie Voraussetzung für das libysche Visum ist. Ein anerkannter Übersetzer muß alle wichtigen Daten des Passes ins Arabische übertragen. Sie werden in einen Stempel eingetragen, den man sich zuvor auf einer größeren Stadtverwaltung in Deutschland besorgen muß. Jetzt können wir mit Hilfe dieser Übersetzung erahnen, was auf der Einreisekarte einzutragen ist. Wir bekommen einen Einreisestempel in den Paß, das war es schon. In Zuara, dem nächsten größeren Ort, sollen wir zum Zoll, um uns libysche Autokennzeichen und -papiere zu besorgen.
Am Straßenrand stehen zahlreiche Plakatwände mit heroischen Abbildungen Gadhafis. Auf einem dieser Plakate thront der Oberst auf einem Bulldozer und reißt höchstpersönlich die Grenzstation zum Nachbarland Tunesien nieder. Zwischen den beiden Staaten besteht ein Abkommen, das Zollkontrollen überflüssig macht. Tunesier und Libyer brauchen keine Visa zum Besuch des Nachbarlandes. Bis vor knapp zwei Jahren war es noch fast unmöglich, das Land als Tourist zu besuchen. Doch dann hat Gadhafi eine neue Leitlinie herausgegeben: "Die wahre Völkerverständigung kann nicht zwischen den Regierungen, sondern nur zwischen den Völkern selbst stattfinden." Er ließ die Grenzen zu allen Nachbarstaaten öffnen. Für Touristen ist es jetzt kein Problem mehr, ein Visum zu erhalten.
Das Zollgebäude in Zuara ist zwar gut versteckt am Ortsausgang, aber mit Nachfragen schnell gefunden. Doch dort erwartet uns eine Enttäuschung: "Wo ist denn ihre Haftpflichtversicherung?", fragt uns der Zöllner. Er erklärt uns, daß wir an der Grenzstation eine hätten abschließen sollen. Also müssen wir die vierzig Kilometer wieder zurückfahren. Dort ist in einem weiteren Container tatsächlich ein kleines Versicherungsbüro. Die Haftpflicht für einen Monat soll drei Dinar kosten, nach tunesischem Straßenkurs sind das drei Mark. Aber es erscheint uns etwas dreist, mit nicht offiziell getauschtem Geld zu bezahlen. Deshalb behaupten wir, kein libysches Geld zu besitzen und fragen nach einer Bank. Den Libyer, der uns fleißig eine Versicherungspolice ausstellt, interessiert unser Geld gar nicht. Schweigend schiebt er uns die Police zu - bezahlen brauchen wir nicht.
Zurück zum Zoll in Zuara: Der nächste Schock sind die Gebühren für die Nummernschilder. Sie sollen sechzig libysche Dinar kosten. Zwar sind davon fünfzig Dinar Kaution, doch die bekommen wir nur zurück, wenn wir an diesem Grenzübergang wieder ausreisen. Aber das kommt für uns ja nicht in Frage. Auch jetzt trauen wir uns nicht, ausgerechnet einem Zöllner Geld anzubieten, für das wir keine Wechselquittung haben. Da es inzwischen Donnerstag nachmittag ist, sind alle Banken geschlossen. Was also tun? Der Zöllner schlägt vor, daß er uns das Geld zum Bankkurs tauscht. Wir atmen einen Moment auf. Aber dann bleibt uns die Luft weg: Der Bankkurs ist fünfmal schlechter als der tunesische Straßenkurs. Wir müssen somit 350 Mark bezahlen. Doch es bleibt keine andere Möglichkeit. Selbst bis Samstag zu warten, bis die Banken wieder geöffnet haben, würde nichts bringen. Dort ist der Kurs ja genauso schlecht. Für den Zöllner ist es natürlich eine willkommene Gehaltsaufbesserung: Er kann unsere Devisen gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt in libysche Dinar zurücktauschen.
Als letztes sollen wir noch eine Devisenerklärung ausfüllen. Der Beamte meint dazu, wenn wir nicht mehr offiziell tauschen würden, dann sollten wir sie vor der Ausreise einfach wegschmeißen. Uns kommen ernste Zweifel am Sinn dieser Deklaration.
Wir nehmen unsere Nummernschilder, befestigen sie am Bulli und verlassen genervt die Zollstation. Offene Fragen bleiben reichlich: Was ist nun, wenn uns jemand fragt, wie wir an das libysche Geld für die Schilder gekommen sind? Eine offizielle Bankquittung konnte uns der Zöllner ja nicht ausstellen. Ist es jetzt noch sinnvoll, etwas Geld offiziell zu tauschen? Nach der Bemerkung über die Deklaration können wir uns das wohl sparen.
Wie verabredet treffen wir uns mit dem anderen VW-Bus, um uns einen Stellplatz für die Nacht zu suchen. Um den ganzen Ort zieht sich ein Streifen aus Müll. Entweder wird er direkt hier abgeladen oder er hat sich einfach im Laufe der Jahre angesammelt. Nachdem wir diese Abfallberge durchfahren haben, finden wir einen ruhigen Platz. Die beiden anderen wollen am nächsten Tag in Richtung Süden weiter. Für uns würde ein Abstecher in die Libysche Sahara allerdings einen riesigen Umweg bedeuten. Schade, denn dort besitzt Libyen die interessantesten Reiseziele: Naturschönheiten, wie die von Sanddünen umgebenen Mandara-Seen, aber auch sehenswerte Oasenstädte wie Ghat und Ghadamès. In diesen Orten sind die alten Lehmksare und Medinas noch erhalten. Im Norden dagegen hat man die Altstädte dem Erdboden gleichgemacht, da der Platz für moderne Neubauten im sozialistischen Einheitslook gebraucht wurde. So bieten die Städte an der Küste ein eher langweiliges und uninteressantes Bild.
Freitag, 04.12.92
Am Morgen fahren wir noch einmal zur Zollstation. Wir hatten uns gestern bei der Devisendeklaration verrechnet und wollen dies nun korrigieren. Es ist kein Problem: Die alte Deklaration fliegt in den Müll, wir bekommen eine neue, von der jetzt aber kein Durchschlag existiert. Das Ganze scheint also wirklich nutzlos zu sein.
Unser Weg führt uns an der Küste entlang in Richtung Osten. Bisher hat sich Libyen ja als relativ problemlos erwiesen, wenn man mal von dem Wirrwarr in der Zollstation und den teuren Nummernschildern absieht. Allerdings ist das Preisniveau ansonsten sehr günstig. Bei den zahlreichen Obst- und Gemüseständen an der Straße kann man preiswert einkaufen und Diesel ist phänomenal billig: 8,5 Pfennige für einen Liter. Für weniger als fünf Mark ist der Bulli vollgetankt. Erstaunlich ist auch, daß in diesem Land kaum Polizei sichtbar ist. So wenige Polizeiposten wie hier haben wir in noch keinem arabischen Land erlebt. Fast alle der Straßenkontrollhäuschen sind unbesetzt. Sich frei im Land zu bewegen, ist ohne Komplikationen möglich, solange man den militärischen Sperrgebieten fernbleibt. Von einem Polizeistaat kann kaum die Rede sein, jedenfalls ist er nicht offen sichtbar. Die libysche Geheimpolizei dagegen agiert im Untergrund. Sie ist sehr aktiv und gefürchtet.
Schwierigkeiten macht uns dafür die Beschilderung. Es wurde konsequent alles Nichtarabische verbannt. Gadhafi ließ nach seiner Machtübernahme sämtliche Schilder mit lateinischen Buchstaben entfernen, da dies für ihn die Schrift des Kolonialismus war. Geschäfte, Ämter, Hotels und Verkehrsschilder sind ausschließlich in Arabisch beschriftet. Auf die Frage, warum er es denn den Ausländern so schwer machen würde, antwortete Gadhafi einem englischen Journalisten: "In England gibt es ja auch keine arabischen Ortsbezeichnungen." Auch bei der gesprochenen Sprache ist Arabisch Trumpf: Bei unseren Versuchen, den Weg zu erfragen, ernten wir zumeist Unverständnis. Unser Anfängerarabisch ist uns auch keine allzu große Hilfe, da sich der libysche Dialekt von dem des Maghreb deutlich unterscheidet. Lediglich die vielen Gastarbeiter aus den Maghreb-Staaten sprechen manchmal etwas Französisch.
Gegen Mittag erreichen wir Sabratha, eine kleine Stadt mit Ruinen aus römischer Zeit. Da es ansonsten im Norden kaum Sehenswürdigkeiten gibt, stellen die zahlreichen antiken Überreste der Römer eine willkommene Abwechslung dar. Auch wenn wir nicht gerade Fans römischer Ausgrabungen sind, finden wir das Theater mit seiner dreistöckigen Säulenfront doch sehr sehenswert. Der gute Zustand und besonders die Lage direkt am Meer machen es zu einem schönen Platz für eine Pause.
Die Hauptstadt Tripolis umfahren wir auf einer autobahnähnlichen Ringstraße. Überhaupt sind die Straßen bisher fast alle vierspurig und in gutem Zustand. Selbst zu den abgelegensten Oasendörfern führen Teerstraßen. In weniger guter Verfassung sind dafür die Autos, die sich darauf tummeln. Viele bestehen nur noch aus einer Ansammlung von Beulen, die von rostigem Blech zusammengehalten werden. Unzählige Wracks wurden einfach am Straßenrand zurückgelassen. Aber bei dem Kamikaze-Fahrstil, der hier vorherrscht, sind Unfälle mit Totalschaden keine Seltenheit. Es wird nicht auf den umgebenden Verkehr geachtet. Vollgas und rauf auf die Straße ist die allgemeine Devise. Wir gewöhnen uns eine extrem defensive Fahrweise an, da wir befürchten, ansonsten nicht unversehrt das Land durchfahren zu können oder Kunde in einer der vielen Autowerkstätten zu werden. Nicht ohne Grund reiht sich an den Hauptstraßen der Städte eine Werkstatt an die andere. Sie machen mit skurrilen Baumgebilden aus Blechröhren auf sich aufmerksam. Erst bei genauerem Hinsehen erkennen wir, daß es ineinandergesteckte Auspuffe sind.
Am Nachmittag erreichen wir Khoms. Die Attraktion sind hier die römische Ruinen von "Leptis Magna", die zu den berühmtesten Nordafrikas gehören. Wir machen uns auf die Suche nach dem im Reiseführer beschriebenen Hotel "Tourist Khoms". Die Post, in dessen Nähe es sein soll, ist schnell gefunden. In ganz Libyen sind die Postämter am alles überragenden Fernmeldeturm erkennbar. An dem Hotel fahren wir jedoch zweimal vorbei. Obwohl es nicht gerade klein ist, ist das schlichte Gebäude von außen nicht unbedingt als Hotel zu erkennen. Und auch der arabische Schriftzug "Funduq" (Hotel) ist so klein, daß er leicht übersehen werden kann. Wenigstens erweist sich die Unterkunft als komfortabel und günstig.
Der Ort dagegen ist enttäuschend. Die Atmosphäre ist nicht mit anderen arabischen Städten vergleichbar. Es gibt nur wenige Lokale und Cafés, in denen man im Freien sitzen kann und auch die sonst so typischen Straßenhändler sind kaum zu sehen.
Auch Frauen sind hier, wie überall in Libyens öffentlichem Leben, kaum vertreten. Gadhafi fördert zwar ihre Gleichberechtigung im beruflichen und politischen Bereich, indem er ihnen sogar Minister- und Richterämter zur Verfügung stellt. Es gibt auch eine eigene Militärakademie für Frauen, wo ihnen die Offizierslaufbahn offensteht. Auf gesellschaftlicher Ebene und im öffentlichen Leben herrscht aber noch immer strikte Abschirmung. Hier prallen die geförderte Gleichstellung im Beruf und die althergebrachte Tradition islamischer Gebräuche hart aufeinander.
Die Libyer sind außerordentlich zurückhaltend. Obwohl Touristen hier rar sind, erregen wir kein Aufsehen. Wenn wir mit jemandem ins Gespräch kommen, ist stets die erste Frage, wo wir denn in Libyen arbeiten würden. Man hält uns für Gastarbeiter. Die Mehrzahl der ausländischen Arbeitskräfte stammt zwar aus arabischen Nachbarländern, aber auch viele Europäer sind hier tätig, vor allem als Spezialisten in der Erdölindustrie. Die meisten der Libyer arbeiten in der Verwaltung und im Handel. Fast alle anderen Tätigkeiten werden von Ausländern verrichtet, die über 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung stellen. Ihre Zahl schwankt stark, da es von Zeit zu Zeit immer wieder zu Ausweisungswellen arabischer Gastarbeiter kommt.
Am nächsten Tag besichtigen wir die römischen Ruinen von Leptis Magna. Die Ursprünge stammen aus phönizischer Zeit, unter den Römern erlebte die Stadt ihre Blüte. Es sind nicht so sehr die einzelnen Bauwerke, die uns faszinieren, beeindruckend ist vielmehr die Gesamtheit der Anlage. Auf alten Wegen, unter deren Pflasterung wir alte Wasserleitungen erkennen, wandern wir durch die antike Stadt. Besonders die Thermen des Kaisers Hadrian geben einen guten Eindruck vom pompösen Lebensstil der Römer. Erstaunlich gut erhaltene Wandmalereien mit Jagdszenen zieren die Wände. Das riesige Theater, das größte Nordafrikas, war das Prunkstück der Stadt. Seine Zuschauerränge und die Bühne sind heute noch fast vollständig erhalten. Geschmückt wird es von zahlreichen Götterstatuen. Durch kleine Gassen, gesäumt von Marmorsäulen, gehen wir weiter zum Marktplatz. Da hier zahlreiche steinerne Marktstände noch erhalten sind, können wir uns gut vorstellen, wie einst die Waren angepriesen wurden. Überhaupt ist dies das Schönste an Leptis Magna: Es fällt nicht schwer, sich in Gedanken in die Zeit der Römer zurückzuversetzen.
Seit den Römern hatten stets fremde Herrscher die Macht in Libyen. Einen einheitlichen libyschen Staat hat es vor dem 20. Jahrhundert nicht gegeben. Nach den Römern regierten Vandalen, Byzantiner und Araber. Ab 1551 gehörte Libyen zum Osmanischen Reich, bis Italien nach dem Sieg im Krieg gegen die Osmanen 1912 das Gebiet erhielt. Die Italiener hatten zunächst nur Kontrolle über die nördlichen Landesteile. Als 1922 Faschisten die Regierung in Italien übernahmen, wurde der Kampf um Libyen härter. Mussolini nannte es die "vierte Küste Italiens". Die Italiener legten Konzentrationslager in der libyschen Wüste an, lange bevor es sie in Deutschland gab. Dort ermordeten sie diejenigen, die Widerstand gegen die Kolonialisten leisteten, zum Teil ganze Dörfer. Das fruchtbare Land an der Küste wurde unter 100 000 italienischen Siedlern aufgeteilt. Da nach Mussolinis Ideologie Araber eine minderwertige Rasse waren, wurden die Libyer von der Küste in die Wüste verbannt oder aber im Zweiten Weltkrieg verpflichtet, in die italienische Armee einzutreten. Gemeinsam mit "Wüstenfuchs" Rommel kämpften sie in Nordafrika gegen die Alliierten.
Eine Sekte namens "Senussi" schloß sich dagegen den Engländern an. Sie sind eine islamische Bruderschaft, die Anfang des 19. Jahrhunderts von Mohammed ibn Ali as-Senussi gegründet wurde. Besonders die Nomaden der libyschen Wüste schlossen sich ihr an. Ihre Ziele waren die Reinhaltung des Islam und eine Besinnung auf die Askese, aber auch die Vertreibung der damals herrschenden Osmanen. Die Senussi gründeten zahlreiche Niederlassungen im gesamten Sahararaum und kontrollierten schon bald den Karawanenhandel in der östlichen libyschen Wüste. Abgeschreckt durch die Kolonialpolitik der Franzosen im Nachbarland Algerien, ließen die Senussi keinen Europäer in ihr Gebiet eindringen. Aber gegen die italienischen Faschisten, die ihre Macht immer weiter in den Süden ausbreiteten, hatten sie keine Chance. Tausende kamen in den Konzentrationslagern ums Leben oder flüchteten ins Exil.
Nach dem Sieg der Engländer gegen die Deutschen und Italiener wurde Idris, ein Senussi, im Jahre 1951 König des unabhängigen Libyen. Es bestand aus drei Bundesländern: Tripolitanien im Westen, die Cyrenaika im Osten und der Fezzan im Süden. Obwohl die wirtschaftliche Situation äußerst schlecht war, leistete man sich jeweils eine Regierung in den einzelnen Ländern und eine Zentralregierung. Diese knüpfte enge Beziehungen zu den westlichen Industrieländern. Amerikaner und Briten konnten im Norden Militärstützpunkte errichten und auch die Förderkonzessionen für die erwarteten Erdölfunde gingen ins Ausland. Libyen hatte zum Aufbau einer eigenen Wirtschaft keine finanziellen Mittel und war daher auf ausländisches Kapital angewiesen.
Die ersten Jahre der Unabhängigkeit verliefen relativ ruhig. Doch Ende der 50er-Jahre kam es in der gesamten arabischen Welt zu Unruhen. Der Unabhängigkeitskrieg in Algerien, der Suez-Krieg in Ägypten und die Beendigung der Monarchie im Irak führten auch in der libyschen Bevölkerung zu einer ablehnenden Haltung gegenüber den westlichen Ländern, die nach wie vor großen Einfluß auf das Land hatten. Diese Ablehnung verstärkte sich, als 1961 mit dem Export von Öl begonnen wurde und daraufhin viele ausländische Facharbeiter ins Land kamen. Die ausländischen Fördergesellschaften konnten ihre Konzessionen verlängern. Dabei wurden nicht unerhebliche Bestechungsgelder an die libyschen Regierungsmitglieder gezahlt, um die Förderrechte zu möglichst günstigen Konditionen zu erhalten.
In der arabischen Welt geriet Libyen immer mehr unter Druck. Vor allem der damalige ägyptische Präsident Gamal Abd al-Nasser, der die Einheit aller arabischen Staaten erreichen wollte und westlichen Einfluß ablehnte, wurde zum Kritiker libyscher Politik. Nach libyscher Auffassung war der israelisch-palästinensische Konflikt nur eine Sache der direkt an Israel grenzenden Staaten. Doch in der libyschen Bevölkerung wuchs der Widerstand gegen diese Haltung. Dieser innenpolitische Konflikt verschärfte sich, als Libyen im "Sechs-Tage-Krieg" von 1967 den algerischen Truppen die Durchfahrt verweigerte, die den Ägyptern gegen die Israelis zu Hilfe kommen wollten. Als der inzwischen alte und kranke König Idris 1969 zu einer Kur in die Türkei reiste, kam es am 1. September zur erwarteten Revolution. Eine Gruppe junger Offiziere, darunter Muammar al Gadhafi, übernahm die Regierung, ohne dabei auf großen Widerstand zu stoßen. Die Bevölkerung begrüßte die Abschaffung der Monarchie.
Die neue Regierung des "Revolutionären Kommandorates" änderte den Namen des Staates in "Libysche Arabische Republik" und erließ eine neue Verfassung. Sie orientierte sich an Nassers Ideen und strebte nach einer Vereinigung mit den arabischen Bruderstaaten. Die Erdölgesellschaften wurden verstaatlicht, die amerikanischen und britischen Truppen ausgewiesen. Auch jüdische und italienische Bewohner mußten das Land verlassen. 1977 wurde erneut der Name des Landes geändert. Seitdem ist Libyen eine "Sozialistische Arabische Volks-Djamahiria". Djamahiria heißt "Staat der Massen". Die Verfassung wurde ergänzt: Die Grundlage aller Gesetze soll der Qur'an sein. Männer und Frauen sind wehrpflichtig. Die "Volksautorität" bestimmt das neue politische System.
Gadhafi hat seine Ideen zu politischen, wirtschaftlichen, religiösen und sozialen Themen in seinem "Grünen Buch" niedergeschrieben. Es zeigt den seiner Meinung nach "einzig wahren Weg in die Volksherrschaft der neuen Ära" und verheißt den Völkern "die Erlösung von allen Zwängen, außer denen Allahs und der Masse". Seine "Dritte Universaltheorie" sieht vor, daß die Menschen nicht ihren hemmungslosen Individualismus austoben. Sie sollen durch "echte Hingabe an Allah und im Dienste der Gemeinschaft" ihre Persönlichkeit ausbilden. Nach Gadhafis Ansicht nimmt dies " wirkliche Rücksicht auf die Natur des Menschen". Weiterhin sollen laut dieser Theorie alle Entscheidungen von Volkskomitees getroffen werden. Diese Komitees werden von Basisvolkskonferenzen, die jedem Libyer und jeder Libyerin offenstehen, gewählt. So soll ein "System der direkten Demokratie" verwirklicht werden. Gadhafi beansprucht für sich allerdings ein Vetorecht. Der Ministerrat wurde in "Allgemeines Volkskomitee" umbenannt, Gadhafi wurde zum "Revolutionären Denker". Betriebe wurden von "Volkskomitees" übernommen und Botschaften in "Volksbüros" umbenannt. Der Einzelhandel wurde verstaatlicht und durch riesige "Volksläden" ersetzt. 1988 machte das Volk jedoch von seiner Macht Gebrauch: Es setzte die Wiedereinführung des privaten Handels durch.
Gadhafi strebt einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus an. Kernpunkte seines Programms sind die Arabische Einheit, der "Kampf gegen Zionismus und Imperialismus" und die Blockfreiheit des Landes. Sein Ziel ist ein islamischer Staat. Allerdings nicht wie islamische Fundamentalisten ihn wollen, sondern nach seinen eigenen Vorstellungen. Diese wiederum verändern sich ständig. Kaum ist eine Idee propagiert, wird sie schon wieder durch die nächste abgelöst. Die islamische Zeitrechnung wollte er um zehn Jahre korrigieren. Die "Hadithe", die Aussprüche und Taten des Propheten, wollte Gadhafi zunächst "ausbessern". Schließlich erklärte er sie für unannehmbar und zog sich so den Zorn der islamischen Gelehrten zu. In ihren Augen stellt sich Gadhafi über den Propheten Muhammad. Sein Grünes Buch wird gelegentlich auch zynisch als "Libyscher Qur'an" bezeichnet, denn Gadhafis islamischer Staat soll sich mehr an diesem Buch als am Qur'an orientieren.
Innenpolitisch kann Gadhafi durchaus Erfolge vorweisen. Die Mehrheit des Volkes steht hinter ihm, auch wenn sein Vorgehen gegen Oppositionelle immer wieder von Menschenrechtsorganisationen verurteilt wird. Speziell ausgebildete "Hinrichtungskommandos" sollen Regierungskritiker beseitigen. Wirtschaftlich steht das Land an der Grenze zum Wohlfahrtsstaat. Es hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen Afrikas, wobei niedrige Einkommen steuerfrei bleiben. Es gibt ein Sozialversicherungssystem und freie Krankenversicherung. Verglichen mit anderen afrikanischen Ländern ist das Gesundheits- und Bildungssystem auf einem sehr hohen Stand. Möglich wurde dies durch die immensen Einnahmen aus der Ölförderung. 99,9 Prozent seiner Exporterlöse erzielt Libyen durch Erdöl und Erdölprodukte. In jüngster Zeit ist der Staat allerdings in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Der gesunkene Ölpreis ist ein Grund, noch entscheidender sind jedoch das noch immer andauernde Handelsembargo der USA und der Luftfahrtboykott der UNO. Die Weltorganisation verlangt die Auslieferung von zwei mutmaßlichen libyschen Terroristen. Sie sollen das Attentat auf das amerikanische Flugzeug verübt haben, das Weihnachten 1988 über dem schottischen Ort Lockerbie abgestürzt ist. 270 Menschen starben dabei. Libyen verweigert die Auslieferung, da es nicht mit Sicherheit geklärt ist, ob die beiden tatsächlich schuldig sind. Auch Syrer und die PLO werden mit dem Attentat in Verbindung gebracht. Libyen verlangt ein Verfahren vor einem Gericht eines unbeteiligten Landes. Völkerrechtlich ist die Auslieferungsforderung umstritten. Es ist das erste Mal, daß sich die UNO direkt in einen Rechtsstreit zweier Mitgliedsstaaten einmischt und verlangt, daß ein Land eigene Staatsbürger ausliefert.
Außenpolitisch hat Gadhafi weniger Erfolg als im eigenen Land. Im Westen wird ihm vorgeworfen, in zahlreiche Terrorakte verstrickt zu sein. Tatsächlich hat er diverse Terrorgruppen unterstützt, wobei sein Ziel meist internationale Aufmerksamkeit war. Als Führer eines eigentlich relativ unbedeutenden Landes sucht Gadhafi immer wieder nach Möglichkeiten, Stärke zu demonstrieren. Er stellt sich stets auf die Seite der Oppositions- und Untergrundbewegungen. Diese unterstützt er im "Kampf gegen die Imperialisten". Sein verbaler Schlagabtausch mit den USA begann 1986 nach der angeblichen Verwicklung Libyens in den Anschlag auf eine amerikanische Bar in Berlin. Er endete mit der Bombardierung der Städte Tripolis und Bengazi durch die Amerikaner. Dabei starben 41 Menschen, darunter auch Gadhafis Adoptivtochter. Er entging selbst nur knapp dem Tod. Seitdem hält er sich mit antiamerikanischen Attacken zurück. Die UNO verlangt, daß Libyen "umgehend durch konkrete Akte beweisen muß", daß es auf Terrorismus verzichtet. Gadhafi lehnt dies ab. Er kann es sich leisten, denn trotz seines schlechten Rufes ist Libyen als Wirtschaftspartner begehrt. Europäische Länder importieren große Mengen libyschen Erdöls. Auf der Gegenseite werden Aufträge an westliche Firmen reichlich vergeben und sind lukrativ. Außerdem importiert Libyen westliche Konsumgüter in großen Mengen.
Auch in der arabischen Welt ist Gadhafi nicht gerade beliebt. Zu oft hat er die Seiten gewechselt, hat mal diese und mal jene Gruppe unterstützt. Sein Verhältnis zur PLO ist bezeichnend: Libyen bezeichnet zwar Israel als seinen Feind und lehnt den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag als "faulen Kompromiß" entschieden ab. Es ist jedoch das einzige arabische Land, daß die PLO nicht unterstützt. Gadhafi schlug einst dem PLO-Führer Jassir Arafat vor, er würde den Palästinensern Geld geben, wenn sie sein Grünes Buch als ideologische Grundlage annähmen. Arafat lehnte dankend ab. Dafür unterstützt Gadhafi seitdem palästinensische Splittergruppen und einzelne Terroristen, um so die PLO zu spalten.
Immer wieder hat Gadhafi versucht, Libyen mit anderen arabischen Ländern zu vereinigen, um so den Grundstein für einen einheitlichen arabischen Staat zu legen. Doch ein dauerhafter Erfolg blieb aus. Daraufhin wandte er sich nichtarabischen Ländern zu. Er versuchte Libyen mit Malta, mit dem Iran, mit Äthiopien, mit Uganda und mit Zentralafrika zu vereinigen. Stets war sein Ziel, unangefochtener Gesamtstaatschef zu werden. Jede Vereinigung Libyens mit einem anderen Staat war zugleich als erster Schritt zur "Universalen Einheit" gedacht. Diese Einheit ist einer der Kernpunkte in Gadhafis "Dritter Universaltheorie".
Sonntag, 06.12.92
Von den fast 2000 Kilometern entlang der libyschen Küste haben wir bisher gerade mal 300 hinter uns. So wird es heute ein reiner Fahrtag. Der Verkehr, der bisher recht chaotisch und dicht war, wird langsam geringer. Die Vegetation wird immer spärlicher, die Wüste reicht fast bis an das Mittelmeer heran. Wir haben die dicht besiedelten Gebiete verlassen - ab hier leben wahrscheinlich mehr Kamele als Menschen. Zwar wohnen 95 Prozent der Libyer im schmalen Küstenstreifen, aber größtenteils in wenigen fruchtbaren Gebieten und einigen großen Städten. Diese kündigen sich stets schon etliche Kilometer im Voraus durch die zunehmende Anhäufung von Abfall an. Erst hängen einige verstreute Plastiktüten wie Fahnen in den trockenen Dornbüschen, dann verdichtet sich der Müll. Wenn man den Ortseingang erreicht, hat man Abfallberge hinter sich gelassen, die bei uns eine ganze Deponie füllen könnten. In den Städten und Dörfern sieht es genauso ungepflegt aus. Müll überall und die Häuser verfallen. Seit der Neubauwelle in den siebziger Jahren wird an ihnen offensichtlich nichts mehr repariert. Damals wurde innerhalb weniger Jahre der Wohnungsbestand fast verdoppelt. Heute verfallen die Bauten schon wieder. In gutem Zustand und stets frisch gestrichen sind dagegen die Moscheen. Fleißig werden neue errichtet, zum Teil in auffallend modernem Stil und oft in grellen Farben. Je weiter wir nach Osten fahren, desto häufiger haben sie schlanke, runde "Bleistiftminarette". Im Maghreb herrschen dagegen Minarette mit eckigen Grundrissen vor.
In der menschenleeren, graubraunen Wüstenlandschaft liegen immer wieder große eingezäunte Gebiete, die klar auf eine militärische Nutzung schließen lassen. Wir sind etwas besorgt, daß wir bei der Schlafplatzsuche aus Versehen in ein solches Gebiet geraten könnten. Die Zäune sind oft im lückenhaften Zustand, verrostete arabische Schilder lassen - wenn sie überhaupt vorhanden sind - auf Warntafeln schließen. Allerdings wird Libyens Militär immer wieder überschätzt: Es verfügt zwar über reichlich Material, aber noch nicht einmal über genügend Soldaten und Soldatinnen, die alle Panzer und Flugzeuge besetzen könnten. Das Fotografieren unterlassen wir im ganzen Land, da immer die Gefahr besteht, irgend ein militärisches Objekt mit auf dem Bild zu haben. Und Lust auf die Bekanntschaft der Geheimpolizei haben wir nun wahrlich nicht.
Eine LKW-Kolonne mit jeweils zehn Kamelen auf der Ladefläche kommt uns entgegen. Die Zeit der Karawanen ist auch im ehemaligen Nomadenstaat Libyen zu Ende. Heute übernehmen Lastwagen sämtliche Transporte, auch den der Kamele zum Schlachthaus.
Seit 2000 Jahren ist das Kamel im Sahararaum verbreitet. Den klimatischen Verhältnissen der Wüste ist es ideal angepaßt. Selbst wenn die Temperaturen über 50 Grad steigen, braucht es nur jeden vierten Tag Wasser, ansonsten etwa alle zwei Wochen. Aber wenn ein Kamel einmal trinkt, so können es durchaus an die 200 Liter sein. Im Notfall verträgt es sogar Salzwasser. Das Wasser wird in Speicherzellen in einem seiner drei Vormägen und chemisch gebunden im Fettgewebes des Höckers angelegt. In Notzeiten wird es freigesetzt, wobei das Kamel bis zu einem Viertel seines Gewichts verlieren kann. Bei extremen Temperaturen kann es seine Körpertemperatur um neun Grad auf bis zu 42 Grad ansteigen lassen. Dieses "kontrollierte Fieber" verhindert Schwitzen und spart Wasser. Ein Kamel ist äußerst genügsam. Es frißt dürre Halme, Dornengestrüpp, trockene Blätter und, wie ein Beduine einmal scherzte, "even old newspapers".
Ein nomadisches Leben in den abgelegenen Gebieten der Sahara wäre ohne das Kamel nicht möglich. Kamele bedeuten Reichtum und Stolz. In einem Lied der Tuaregfrauen heißt es: "Der junge Mann, der kein Kamel hat, weil sein Vater ihm keines gibt, weil er kein Geld hat, eins zu kaufen, der ist bedauernswert." Auch wird der Brautpreis traditionell mit Kamelen bezahlt. Eigentlich gilt es als schmachvoll, diesen mit anderen Tieren zu ersetzen, aber vielen Nomaden bleibt in ihrer heutigen Armut nichts anderes übrig. Ein Kamel ermöglicht Mobilität als Reit- und Transporttier. Früher hing das Leben der Nomaden noch stärker von den Fähigkeiten des Kamels ab. Sie entschieden über den Ausgang eines Raubzuges oder über den Erfolg einer Handelskarawane. Die Kamelmilch war dabei oft die einzige Nahrung, der Mist das einzige Brennmaterial. Auch sonst ist der Lebensalltag der Nomaden eng mit dem Kamel verknüpft. Die Dauer einer Reise messen sie in Kameltagen, ihr Gewichtsmaß ist eine Kamellast und ein Tag zerfällt in zwei Melkzeiten.
Entsprechend groß ist die Ehrerbietung und Zuneigung, die dem Kamel entgegengebracht wird. Es gibt 160 arabische Bezeichnungen für das Kamel. Die gebräuchlichste "al djamal" ist auch der Begriff für "Zuneigung", "Verehrung" und "Bewunderung". Die sprachliche Wurzel von "Kamel" und "Schönheit" ist dieselbe. Es gibt unendlich viele Gedichte, Redensarten, Weisheiten und Gleichnisse über das Kamel. Eine alte arabische Legende lautet:
"Allah schuf sich die Wüste, damit es einen Ort gebe, darinnen er in Ruhe lustwandeln könne. Aber bald sah er seinen Irrtum ein, und er korrigierte ihn. Er rief den Südwind, den Nordwind und alle anderen Winde und befahl ihnen, sich zu vereinigen. Sie gehorchten ihm, er nahm eine Handvoll des Gemisches und so entstand zum Ruhme Allahs, zur Schande seiner Feinde und zum Nutzen der Menschen das Kamel. Er band an dessen Füße das Mitleid, legte auf seinen Rücken die Beute und in seine Flanken den Reichtum. Er gab ihm - auch ohne Flügel - den Flug der Vögel, und das Glück war an seinem Schwanze angeheftet."
Modernisierung und Landflucht haben das Kamel zusammen mit den Nomaden und Hirten immer mehr verdrängt. Heute ist das Kamel für die jüngere Generation ein Symbol der Rückständigkeit. Statt Handelskarawanen ziehen Herden von Schlachtkamelen durch die Straßen. Sie dienen der Stadtbevölkerung als billige Fleischmahlzeit. Bei den Nomaden gibt es Kamelfleisch nur zu Festanlässen.
Wir sind inzwischen zu echten Kamelfans geworden. Der stets liebenswert erhabene, aber absolut arrogante Blick und die seltsame Gestalt des Kamels, plump und elegant zugleich, sind schon eine ganz besondere Mischung. Wir werden niemals verstehen, warum dieses störrische und eigenwillige Tier am Ende doch stets macht, was sein Besitzer von ihm fordert. Nach dem lauten Protestgebrüll folgt aber stets wieder der gleiche gelangweilte, aber hochnäsige und stolze Gesichtsausdruck. Für diesen Blick liefert eine alte Geschichte eine besondere Erklärung:
"Es gibt hundert Namen für Allah, doch Muhammad verriet seinen Anhängern nur neunundneunzig davon. Den hundertsten flüsterte er eines Tages seinem weißen Kamel ins Ohr als Dank dafür, daß es ihm im Momente einer Gefahr zur Flucht verhalf. So kommt es, daß nun alle Kamele den hundertsten Namen Allahs kennen, die Menschen aber nicht. Und dies ist der wahre Grund, weshalb alle Kamele so entsetzlich blasiert, stolz, überheblich und hochnäsig sind, denn sie sind wissend."
Es ist schon traurig mit anzusehen, wie viele dieser Tiere ihr Leben auf der Straße lassen. Hier ist der Verkehr ihr größter Feind: Wir fahren alle paar Kilometer an Kamelkadavern vorbei. Das Verwesungsstadium reicht dabei von fast frisch bis zum blanken Skelett.
Am nächsten Tag überschreiten wir kurz vor Libyens zweitgrößter Stadt Bengazi unsere 10000-Kilometermarke. Damit haben wir mehr als die Hälfte unserer Mittelmeerrundfahrt hinter uns gebracht. Und nach etwa 600 Kilometern scheint hier auch "die Strecke der toten Kamele" zu Ende zu sein.
Die Gegend wird grüner. Das Gebiet gehört zu den wenigen landwirtschaftlich nutzbaren Flächen Libyens. Der "Djebel akhdar", der "Grüne Berg", bringt für libysche Verhältnisse relativ starke Niederschläge. Die ideologische Beeinflussung der Bevölkerung ist allgegenwärtig. An jeder Ortseinfahrt stehen riesige Jubelbögen, die auf das Datum der Revolution von 1969 verweisen. Auf den Sonderbriefmarken ist Gadhafi der "Man of Peace 1992". Auf anderen Marken wird an die palästinensische "Intifada", die "Stone Revolution", erinnert und ganz Israel als palästinensisches Gebiet proklamiert. Große Plakattafeln mit Bildern Gadhafis zeigen ihn, wie er stolz sein Grünes Buch präsentiert oder als Bulldozerfahrer bei einem Bewässerungsprojekt in der Wüste. Der Bau des "großen künstlichen Flusses" ist eines der technischen Lieblingsprojekte Gadhafis. Dazu soll Grundwasser im großen Stil nutzbar gemacht werden.
Im Südosten Libyens entdeckte man gewaltige Mengen fossilen Wassers, dessen Alter auf bis zu 400 Millionen Jahre geschätzt wird. Im Laufe der Erdgeschichte lagerten sich verschiedenartige Sedimente schichtförmig übereinander. Durch das wachsende Gewicht entstanden an einigen Stellen geologische Becken, die einen Durchmesser bis zu 1000 Kilometern und eine Tiefe bis zu 6000 Metern haben. Sie sind mit porösen Sedimenten gefüllt. In ihnen lagerten sich - wie in einem steinernen Schwamm - gewaltige Wassermengen ein. Es sind Reste jahrelanger Dauerregen zur Zeit der Saurier, von geschmolzenen Gletschern der Eiszeit oder aber Reste vom Meerwasser früherer Saharaüberflutungen. Als die Becken gefüllt waren, entstanden riesige abflußlose Seen, wie zum Beispiel der Tschadsee. Vor 30 000 Jahren war er so groß wie das heutige Schwarze Meer, heute ist er fast völlig ausgetrocknet.
In der Sahara gibt es rund ein Dutzend solcher Grundwasserspeicher. Mit dem Wasser aus dem Kufrabecken in Südostlibyen möchte Gadhafi seine braune Libysche Wüste in einen grünen Garten verwandeln. In den Oasen um Kufra entstanden die ersten großtechnischen Bewässerungsanlagen zur besseren landwirtschaftlichen Nutzung des Wüstenbodens. Nach der Ölkrise in den 70er Jahren hoffte Gadhafi dadurch eine größere Unabhängigkeit von den teuren Lebensmittelimporten zu erlangen. Aber das Projekt in Kufra scheiterte. Nur wenige Bauern wollten sich in dieser Gegend ansiedeln, und die Produkte gelangten nicht frisch in die weit entfernten Städte der Küstenregion. Jetzt soll bis Mitte der 90er Jahre ein 2000 Kilometer langes Rohrsystem das Wasser zu den Bauern an der Küste bringen. Täglich sollen zwei Millionen Kubikmeter Wasser in Rohren mit vier Metern Durchmesser aus den Kufrabecken gepumpt werden. Zum Bau der Pipeline wurde ein spezielles Straßennetz nötig. Geschätzte Kosten des Projektes: 25 Milliarden Dollar. Oberst Gadhafi nennt es "das achte Weltwunder" und den "großen menschengemachten Fluß". Ausländische Wissenschaftler und Hydrologen zweifeln an der Genialität dieses Projektes. Sie sehen in ihm einen Raubbau an der Natur, der in einer ökologischen Katastrophe enden wird. Denn im Gegensatz zu anderen Grundwasserarten regeneriert sich dieses fossile Grundwasser nicht. So wird die Grundlage der traditionellen Oasenbewirtschaftung gefährdet. Schon heute müssen in Kufra immer leistungsfähigere Pumpen das Wasser fördern, denn der natürliche Druck, der noch vor wenigen Jahren das Wasser an die Erdoberfläche steigen ließ, verringert sich zusehends. Der Grundwasserspiegel sinkt durch die Unmengen entnommenen Wassers, und parallel dazu steigt der Salzgehalt im verbleibenden Wasser. Entgegen der offiziellen Ansicht, noch "mehrere hundert Jahre" das Wasser aus dem Kufrabecken nutzen zu können, scheint Gadhafis Traumprojekt zum Scheitern verurteilt.
Am Abend finden wir einen Schlafplatz, mit dem wir nicht ganz zufrieden sind. Wir stehen in der Nähe einer kleinen Straße, aber das Gebüsch um uns herum verdeckt den Bulli nur spärlich. Während wir noch überlegen, ob wir uns nicht trotz der Dunkelheit einen anderen Platz suchen sollen, klopft es an der Seitentür. Wir öffnen und drei Libyer stehen vor uns. Sie wollen anscheinend nur "Merhaba", "Hallo" sagen. Nach dem üblichen "Woher? Wohin? Libyen schön?" gehen sie wieder. Daß sie auch nach "Whisky" und "Camera" fragen, beunruhigt uns nicht weiter. Auch die alte Jagdflinte, die einer der drei über der Schulter hängen hat, macht uns noch nicht mißtrauisch. Kurz darauf klopft es erneut, aber es ist niemand zu sehen. Dann Schritte, es klopft mal vorn, mal hinten, aber niemand antwortet auf unsere Fragen. Erkennen können wir in der Dunkelheit nichts. Langsam wird uns die Situation zu unheimlich und wir sind fest entschlossen, den Standplatz zu wechseln. Aber einer der Männer steht direkt vor uns. Als er sieht, daß wir ihn durch unsere Vorhänge beobachten, legt er sein Gewehr auf uns an. Wir gehen in Deckung. Erst nach einer ganzen Weile trauen wir uns, wieder vorsichtig nach draußen zu spähen. Der Libyer steht nicht mehr vor uns, sondern neben dem Auto. Schnell krabbeln wir durch unsere Luke nach vorne in die Fahrerkabine. Geduckt glühen wir den Motor vor und hoffen, daß sie uns keine Steine vor die Reifen gelegt haben. Wir starten und fahren an. Keine Steine, ein Glück! Jetzt das Licht an und schnell weg hier. Wir sind schon auf der Straße, als Steine das Bulliheck treffen. Wir geben Vollgas und fahren, bis wir uns sicher fühlen.
Es ist uns nicht ganz klar, ob wir einfach nur Glück gehabt haben oder ob die ganze Aktion nicht nur ein schlechter Scherz war. Denn wenn die Libyer uns wirklich überfallen wollten, hätten sie uns auch direkt das Gewehr unter die Nase halten können. Auf jeden Fall sitzt der Schreck tief. Mit einer Situation wie dieser muß man zwar immer rechnen, wenn man wild campt. Aber jetzt wird uns wieder klar, wie wehrlos wir doch eigentlich sind. Mit unserem Sprühgas oder unserem Brotmesser hätten wir uns nicht wehren können. Eine Waffe besitzen wir nicht, da es ist sowieso fraglich ist, ob sie überhaupt etwas nutzt oder ob dadurch nicht im Ernstfall die Situation zusätzlich verschärft wird. Ganz abgesehen davon, daß Ärger an jeder Grenze vorprogrammiert wäre.
Jetzt wollen wir nichts weiter als eine sichere Nacht. Wir erinnern uns an eine Polizeistation ein paar Kilometer zurück an der Hauptstraße. Wir fragen um Erlaubnis, ob wir uns daneben stellen dürfen. Ein müde wirkender Polizist nickt verschlafen. Hoffentlich können auch wir bei dem Straßenlärm genauso gut schlafen wie er.
Dienstag, 08.12.92
Um halb sieben klopft es erneut an der Seitentür. Im Halbschlaf öffnen wir das Fenster ein Stück und ein Polizist hält uns Datteln und zwei Orangen entgegen. Leicht verlegen wünscht er uns einen guten Morgen: "Sabah al-kheir". Eine halbe Stunde später wieder ein Klopfen und zwei Gläser Tee werden uns gereicht. Kurz darauf stehen zwei weitere Uniformierte vor der Tür und vervollständigen unser Frühstück mit frischem Brot.
Auf den letzten 500 Kilometern bis zur ägyptischen Grenze fahren wir bei Tubruq an Gedenkstellen für die Toten des Zweiten Weltkriegs vorbei. Im Gebiet von hier bis zum ägyptischen Al-Alamein kam es zu den schwersten Gefechten zwischen den Truppen von "Wüstenfuchs" Rommel und den Alliierten. Die Schlacht um Tubruq dauerte über zwei Jahre. Noch heute zeugen Millionen im Sand vergrabener Fliegerbomben, Minen und Granaten von der Grausamkeit dieser Kämpfe. Direkt hinter Tubruq beginnt die sogenannte Todeszone. Jedes Jahr kommen Menschen, vor allem Nomaden, durch Minen ums Leben. Die Regierungen der Staaten, die diese vor 50 Jahren vergruben, verweigern heute die Mithilfe bei der Räumung. Weder England, Frankreich, Deutschland noch Italien entsenden ausgebildete Minensucher oder spezielle Räumfahrzeuge. Ein deutscher Bombenexperte leistet Freiwilligenarbeit und gräbt gemeinsam mit einem libyschen Team die noch scharfen Sprengkörper per Hand und Schaufel aus. Allein in den letzten zwei Jahren fanden und entschärften sie 30000 Minen.
Schon weit vor der ägyptischen Grenze stoppt uns die libysche Ausreisekontrolle. Man fragt uns auch nach den ägyptischen Visa, die natürlich in unseren anderen Pässen sind. Beim Anblick der vier Pässe bekommt der Zöllner ganz große Augen und fordert mich auf, mit zu seinem Chef zu kommen. Zum Glück spricht der etwas Englisch und ich kann ihm klarmachen, daß einer von Kirstins Pässen fast abgelaufen ist und sie daher zwei hat. Warum wir beide je zwei besitzen, fragt er zum Glück nicht. Dann sucht er verzweifelt nach unseren Meldestempeln. Normalerweise muß man sich innerhalb einer Woche in einer Bezirkshauptstadt melden. Aber wir sind erst sechs Tage im Land, daher brauchten wir dies nicht. Nach einer Weile sieht er es anhand des Einreisestempels dann auch und wir können weiter. Die bei der Einreise so teuer bezahlten Autonummernschilder haben wir schon abgenommen. Da niemand nach ihnen fragt, bleiben sie uns wenigstens als originelles Souvenir.
nächstes Kapitel Glossar
zurück zur Startseite
Datenschutzerklärung
|